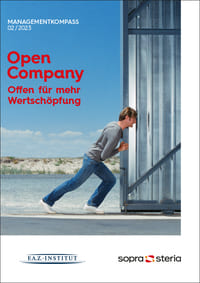Managementkompass Survey
Open Company – offen für mehr Wertschöpfung
Open Company birgt viel wertschöpfendes Potenzial für Unternehmen und die öffentliche Verwaltung, verlangt aber auch gleichzeitig viel Veränderung. Organisations- und branchenübergreifende Kooperationen bieten die Chance auf neue Geschäftsmodelle, bessere Verwaltungsleistungen und mehr Effizienz. Die Vielfalt von Open Company reicht von Open Data über Open Source und Open Innovation bis hin zu Open Business und anderen Elementen. Es geht dabei um ein Miteinander statt ein Füreinander, wodurch komplett neue Wertschöpfungs- und Zusammenarbeitsformate entstehen.
Sopra Steria und das F.A.Z-Institut haben untersucht, wie viel Open-Company-Denke in Wirtschaft und Verwaltung steckt. Für diesen Managementkompass Survey wurden Entscheiderinnen und Entscheider befragt, welche Elemente von Open Company sie bereits anwenden, wie sie kollaborieren und was einer Transformation in Richtung einer Öffnung im Wege steht.
© PM Images – Getty Images
Schritte der Öffnung
Unternehmen und öffentliche Verwaltung müssen heute stärker als je zuvor Herausforderungen meistern, indem sie im besten Fall global, zumindest aber organisationsübergreifend agieren. Gleichzeitig bietet der technologische Fortschritt mehr Möglichkeiten denn je, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und die fast schon als naturgegeben wahrgenommenen Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodelle und Arbeitsabläufe neu zu denken. Dafür bedarf es einer Öffnung, die den Austausch ermöglicht.
Öffnung erfolgt meist verhalten
„Was würde Ihre Organisation mit externen Partnern teilen, um effektiver und innovativer agieren zu können?“; in Prozent der Befragten; n = 271¹
¹ Darstellung ohne Antwortoption „weiß nicht/keine Angabe“ und „Sonstige“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
„Was würde Ihre Organisation intern teilen, um effektiver und innovativer agieren zu können?“;
in Prozent der Befragten; n = 254¹
¹ Darstellung ohne Antwortoption „weiß nicht/keine Angabe“ und „Sonstige“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
An dieser Öffnung hapert es noch: Nur knapp die Hälfte der befragten Entscheiderinnen und Entscheider wäre bereit, die Kompetenzen und Netzwerke ihrer Behörde oder ihres Unternehmens mit externen Partnern zu teilen. Mehr noch: Selbst mit Blick auf eine Öffnung innerhalb der eigenen Unternehmens- oder Behördengrenzen gibt es eine beträchtliche Zurückhaltung. Lediglich drei von fünf Organisationen würden Daten abteilungsübergreifend zugänglich machen. Der Abbau vom Silodenken schreitet nur langsam voran. Der drohende Kontrollverlust trifft auf die Angst, dass Daten falsch verstanden, falsch interpretiert oder falsch verwendet werden könnten. Das zeigt, dass sich die Idee von einer Open Company größtenteils zunächst intern durchsetzen muss.
Die Bereitschaft, sich intern und extern auszutauschen, ist im verarbeitenden Gewerbe am größten. Industriezweige wie Automobilhersteller und Maschinenbauer sind auf besonders vielen Gebieten mit anderen Firmen vernetzt und kooperieren stärker als andere Branchen. Eine breite Open-Company-Kultur ist jedoch auch in der verarbeitenden Industrie nicht flächendeckend etabliert.
„Welche der folgenden Formen der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen nutzt Ihr Unternehmen bzw. Ihre Verwaltung?“; in Prozent der Befragten; n = 226¹
¹ Darstellung ohne Antwortoptionen „weiß nicht/keine Angabe“ und „Sonstige“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Punktuell statt langfristig
Wenn Unternehmen und Behörden die Zusammenarbeit mit externen Partnern suchen, dann am häufigsten zeitlich begrenzt und auf Projektbasis sowie in losen Formaten wie Innovation Hubs und in Workshops. Häufig kooperieren Organisationen zusätzlich zu bereits bestehenden Kunde-Dienstleister- oder Kunde-Lieferanten-Beziehungen. Die punktuelle Kooperation gibt ihnen zudem die Gelegenheit, potenzielle strategische Partner kennenzulernen, die Zusammenarbeit zu testen oder neue Ideen und Anregungen zu sammeln.
Jede zweite Organisation pflegt strategische Partnerschaften mit Akteuren aus der eigenen Branche. Öffentliche Verwaltungen kooperieren besonders stark untereinander und unterstützen sich gegenseitig mit Know-how, Netzwerken und Ideen. Der Umbau zu einer digitalen Verwaltung fordert allerdings auch Kooperation mit Start-ups und anderen Unternehmen mit Tech-Expertise. Formate wie der GovTech-Campus sind ein guter Weg der Öffnung. Davon braucht es weitere und am besten EU-weite Initiativen. Finanzdienstleister sind auf dem Gebiet weiter und profitieren bereits deutlich stärker von der Nähe zu Fintechs und Insurtechs.
Co-Creation, also die Zusammenarbeit von mindestens zwei Parteien in einem gemeinsamen Schöpfungsprozess, kommt selten zum Einsatz. Im Gegensatz zur strategischen Partnerschaft ist dieses Format weitaus weniger bekannt und nicht für jede Problemstellung gleichermaßen geeignet, bietet aber einzigartige Vorteile in Form von innovativen Lösungen und kreativer Synergie. Insbesondere wenn neue Ansätze und Ideen gefragt sind, kann Co-Creation eine überaus wirksame Methode sein.
Grundsätzlich gelten die am häufigsten verwendeten Kooperationsformen auch als die besonders erfolgreichen Formate: Die punktuelle Zusammenarbeit und strategische Partnerschaften funktionieren aus Sicht der Befragten am besten. Das deutet nicht auf einen anstehenden Paradigmenwechsel hin.
Innovation dank Diversität
Co-Creation bedeutet, dass verschiedene Akteure miteinander Neues entwickeln und nicht einfach Teil einer Wertschöpfungskette sind. Diese Form der Gemeinschaftsleistung lebt vom Austausch und damit von der Öffnung. Die verschiedenen Blickwinkel der Beteiligten fördern die Innovationsstärke. Das Zusammenwirken von Vertretern der Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Kultur- oder auch Kreativszene gilt hier als Paradebeispiel.
Durch Technologiedurchbrüche, beispielsweise Blockchain und Künstliche Intelligenz, sowie durch Effekte wie die Corona-Pandemie entstanden viele Labs und Hubs, in denen unterschiedliche Player gemeinsam Ideen, Prototypen und Lösungen entwickeln. Auch wenn viele Digital-Labs wieder schließen mussten, die Co-Creation-Idee hat bei einzelnen Organisationen Einzug gehalten und könnte angesichts von Faktoren wie Fachkräftemangel und zunehmender Vernetzung wieder an Fahrt aufnehmen.
In der Stärke von Co-Creation liegt allerdings auch ihre Schwäche verborgen: Die verschiedenen Perspektiven zu bündeln und zu einer gemeinsamen Idee oder einem tragfähigen Geschäftsmodell zusammenzuführen, ist komplex und erfordert spezielle Kompetenzen und Skills. Co-Creation braucht eine deutlich konsequentere Öffnung einer Organisation und ein Umdenken, was das Risikomanagement und mögliche Beteiligungen an der Wertschöpfung betrifft.
„Welche Form der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren führt Ihres Erachtens zu den innovativsten Ideen?“; in Prozent der Befragten; n = 239
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
„Auf welchen Gebieten pflegt Ihre Organisation enge Partnerschaften mit anderen Organisationen?“; in Prozent der Befragten; n = 213¹
¹ Darstellung ohne Antwortoptionen „weiß nicht/keine Angabe“ und „Sonstiges“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Digitalisierung als Gemeinschaftsaufgabe
Die Kooperations- und Co-Creation-Gebiete variieren je nach Branche. Finanzdienstleister und Verwaltungen wollen so fehlende IT-Kompetenzen durch externe Partner ausgleichen, ihre bestehenden Produkte und Dienstleistungen verbessern und nachhaltiger werden. Das verarbeitende Gewerbe setzt häufiger auf gemeinschaftliche Forschung und Entwicklung, pflegt aber auch Partnerschaften im Bereich IT, Logistik, Vertrieb und Produktion.
Im Hinblick auf die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltungen ist es zudem wenig überraschend, das enge IT-Partnerschaften am weitesten verbreitet sind. Für die Umstellung bedarf es zum einen der technischen Expertise und zum anderen einer neuen Perspektive auf bestehende Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle. Enge IT-Allianzen können durch das gemeinsame Zusammenwirken Potenziale freisetzen, zu denen klassische Dienstleisterbeziehungen kaum in der Lage sind.
Fazit
Trotz vielfältiger Formen der Zusammenarbeit greifen Organisationen meist auf punktuelle Kooperationen zurück. Viele Unternehmen und Verwaltungen trauen sich den konsequenten strategischen Schritt in Richtung einer Open Company entweder nicht zu oder grübeln noch über der richtigen Strategie. Obwohl interdisziplinäre Co-Creation als Quelle für die innovativsten Ideen angesehen wird, nutzt nur etwa jede fünfte Organisation diese Möglichkeit. Gleichzeitig ist kaum eine Organisation bereit, Daten mit externen Partnern zu teilen. Das bremst die Idee eines digitalen Europas und verschenkt Wertschöpfung.
Chancen der Offenheit
Eine Open Company nutzt die Kraft der Zusammenarbeit. Unternehmen und Behörden können von Ideen und Lösungen anderer profitieren und umgekehrt. Sie können gemeinsam Ziele wie Effizienz und Innovationen besser erreichen als allein, und sie können Herausforderungen von außen besser meistern, die beispielsweise mit staatlichen Regulierungen oder Marktveränderungen einhergehen. Ein Blick auf die Motive der befragten Entscheiderinnen und Entscheider zeigt, was Wirtschaft und Verwaltung in Bezug auf mehr Offenheit antreibt und welche Hindernisse sie abhalten.
Nicht nur gut zum Kostensparen
„Was sind die Motive und Ziele, warum Ihre Organisation enge Partnerschaften mit anderen Unternehmen bzw. Verwaltungen eingeht?“; in Prozent der Befragten; n = 208¹
¹ Darstellung ohne Antwortoptionen „weiß nicht/keine Angabe“ und „Sonstiges“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Unternehmen und Behörden öffnen sich für Partnerschaften mit anderen Organisationen aus einer ganzen Reihe von Motiven. Die Palette reicht von Image- und Reputationseffekten über die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, den Zugang zu neuen Märkten, Kompetenzen und Ressourcen bis hin zu einer Tempoverschärfung bei der Entwicklung von Produkten und Leistungen. Ein überragendes Motiv sind die Kosten. Sie sollen durch Kooperationen sinken. Darüber hinaus geht es den Akteuren häufig darum, Wissen auszutauschen. Diese bewährten Motive erklären auch das Verharren in den klassischen Kooperationsformaten. Ansätze wie Co-Creation, bei der sich Organisation deutlich stärker öffnen und Risiken eingehen, sind keine typischen Effizienzbringer. Sie entfalten ihre Stärken, wenn Unternehmen und Behörden innovativer werden wollen und neue Strategien verfolgen.
Ob Cybercrime, Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit oder die Digitalisierung — es gibt immer mehr Herausforderungen, die sich nicht allein bewältigen lassen. Für diese anspruchsvollen Aufgaben sollten Organisationen neue Perspektiven einbeziehen und im Verbund Lösungen entwickeln. Sie sind dadurch schneller und kreativer. Je verwobener und komplexer die Zusammenhänge, desto vielschichtiger und interdisziplinärer sollten die Lösungsansätze sein. Zudem liegt in der Zusammenarbeit die große Chance, echte Lösungen für Probleme zu erreichen und keine falschen Anreize für die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen zu schaffen. Die übergreifende Zusammenarbeit ist der Türöffner zu echter Kunden- und Bürgerzentrierung. Statt Stückwerk entstehen Lösungen aus einem Guss.
„Wer auf Co-Creation verzichtet, lässt Wettbewerbsvorteile liegen.“¹
54%
¹ Zustimmungsquote; in Prozent der Befragten; n = 202
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
„Was hindert Organisationen Ihrer Erfahrung nach daran, häufiger enge Partnerschaften mit anderen Unternehmen bzw. Verwaltungen einzugehen?“; in Prozent der Befragten; n = 211¹
¹ Darstellung ohne Antwortoption „weiß nicht/keine Angabe“ und „Sonstiges“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Offenheit ist eine Frage der Kultur
Offenheit, also Daten, Ideen und Kompetenzen zu teilen und daraus Neues zu entwickeln, erfordert das richtige Mindset. Von den Entscheiderinnen und Entscheidern häufig genannte Hürden für eine Öffnung und eine engere Zusammenarbeit sind jedoch die Angst vor Datenmissbrauch, mangelndes Vertrauen und die Sorge vor Abhängigkeiten — alles Zeichen für das Fehlen des nötigen Bewusstseins für Offenheit.
Die verarbeitende Industrie hat diesbezüglich die größten Vorbehalte: Der Verlust von Daten kann zu Störungen oder dem Ausfall des Produktionsprozesses führen, und ein potenzieller Diebstahl von Know-how stellt ein immenses Risiko für die Unternehmen dar. Die Folgen von Industriespionage, wie finanzielle Risiken oder eine geschwächte Position im Wettbewerb, sind in den Köpfen der Befragten präsent. Etwa jeder zweite Industriebetrieb gibt zudem an, dass eine Kultur für Offenheit im Unternehmen fehlt. Dennoch hat sich gezeigt, dass das verarbeitende Gewerbe bei engen Partnerschaften im Branchenvergleich am weitesten ist. Die Industrie ist aber in vielerlei Hinsicht auch auf Forschungs- und Entwicklungskooperationen angewiesen, die bedacht eingegangen werden.
Finanzdienstleister sorgen sich ebenfalls um ihre Daten. Das größte Hemmnis bei Partnerschaften ist für sie aber die Regulatorik — auch wenn sich viele Vorgaben der Aufsichtsbehörden durch vorhandene Technologien managen lassen.
Kooperationen bei Behörden werden überdurchschnittlich häufig durch Ressourcenmangel behindert. Rund zwei Drittel nennen fehlendes Personal als Hindernis für engere Partnerschaften. Die Schuldenbremse und angespannte Haushalte kommen dazu und erklären, warum Behörden seltener neue Kooperationsformen angehen. Dabei zeigt die Praxis immer wieder, dass Verwaltungen bei Digitalisierungsvorhaben effizienter und innovativer sind, wenn der Partnerkreis größer und heterogener ist und wenn neue Modelle genutzt werden, bei denen Investment, Risiken und Ertrag auf mehrere Partner verteilt sind.
Die wenigsten Organisationen verzichten aufgrund negativer Erfahrungen auf Kooperationen. Selbst bei den Behörden beklagt dies lediglich etwa ein Fünftel der Befragten. Das stimmt zuversichtlich, dass mit einem größeren Erfahrungsschatz Unternehmen und Behörden sich sukzessive für mehr Zusammenarbeit öffnen.
Regularien und rechtliche Fragestellungen werden am häufigsten als Hindernis für die Zusammenarbeit genannt. Rund zwei Fünftel der Befragten vertreten gar die Auffassung, dass der Austausch von Wissen und Technologien durch rechtliche Fragen behindert wird. Die Compliance-Vorschriften in vielen Organisationen sind streng, müssen aber kein Showstopper für das Ziel Open Company sein. Innerhalb der Regeln haben Unternehmen und Behörden eine Menge Freiheitsgrade, und die Komplexität und der Zusatzaufwand lassen sich dank ausgereifter technologischer Instrumente beherrschen und managen.
„Der Austausch von Wissen und Technologien wird durch rechtliche Fragen behindert.“¹
43%
¹ Zustimmungsquote; in Prozent der Befragten; n = 352
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Fazit
Entgangene Chancen einer Öffnung resultieren meist aus der bestehenden Organisationskultur. Zudem werden die Starthürden oft als zu hoch wahrgenommen. Die Voraussetzungen für eine gewinnbringende Zusammenarbeit zu schaffen erfordert ein Investment. Der rechtliche Rahmen muss gefunden werden, und es gilt, die Kooperation personell und strategisch in der Organisation zu verankern. In Anbetracht einer noch von Skepsis geprägten Grundstimmung haben Wirtschaft und öffentliche Verwaltung kulturellen Nachholbedarf. Nur wenn eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gelingt, können alle Parteien auch von den vielfältigen Vorteilen profitieren, die weit über Kosteneinsparungen hinausreichen.
Grundlagen für Offenheit
Ohne offene Daten kann es keine offenen Organisationen geben. Für die Wirtschaft, die öffentliche Verwaltung und die Zivilgesellschaft gilt: Jeder Akteur produziert und nutzt Daten. Das Teilen dieser wertvollen Ressource sowie das Schaffen von Austausch und Interoperabilität bilden die Basis für die gemeinsame Entwicklung neuer Leistungen und neuer Geschäftsmodelle. Es lohnt ein Blick, welche Potenziale bereits genutzt werden.
Open Data für viele (noch) keine Praxis
„Auf welchen Gebieten nutzt Ihre Organisation Open-Data-Angebote anderer Parteien/Akteure oder hat dies bereits in Planung?“; in Prozent der Befragten; n = 200¹
¹ Darstellung ohne Antwortoptionen „keiner der genannten Faktoren“ und „weiß nicht/keine Angabe“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
In offenen Daten steckt ein immenser wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Nutzen. Sie fördern Forschung und Entwicklung, und aus ihnen entstehen Erkenntnisse, die Unternehmen und Behörden für neues Geschäft nutzen. Sie ermöglichen evidenzbasierte Entscheidungen, machen Handlungen transparent und stärken dadurch die Rechenschaftspflicht von Verwaltungen und Unternehmen. Open Data schafft die Basis für neue Beteiligungsformate und hilft bei der Suche nach Lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit. Damit offene Daten ihre volle Wirkung entfalten können, braucht es die Bereitschaft der Akteure, sich an einem Datenökosystem zu beteiligen.
Trotz der Chancen von Open Data schaffen es noch wenige Organisationen, für sich und ihre Stakeholder daraus Kapital zu schlagen. Am häufigsten kommen offene Daten im direkten Zusammenhang mit der Digitalisierung von Geschäft sowie Prozessen und für IT-Infrastrukturvorhaben zum Einsatz. Dazu zählt unter anderem die Analyse des Nutzerverhaltens in Online-Shops und Online-Auftritten. So können etwa Customer oder Citizen Journeys sowie die Angebote verbessert und an die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Services angepasst werden.
Darüber hinaus spielen offene Daten eine wichtige Rolle, wenn es um die Transparenz beim Thema Umwelt und Nachhaltigkeit geht. Finanzdienstleister sind hier in Anbetracht einer verschärften ESG-Regulatorik besonders aktiv. Grundsätzlich ist der Einsatz offener Daten jedoch verhalten. Vielen Organisationen scheint noch nicht bewusst zu sein, wofür beziehungsweise wie offene Daten verwendet werden können, welche Quellen und Plattformen bereits existieren und wie glaubwürdig die Anbieter sind.
Geringes Vertrauen in die Datenqualität
„Wie bewerten Sie grundsätzlich die Datenqualität aus externen Open-Data-Angeboten von Unternehmen? Ich schätze die Daten als …….. hochwertig ein.“; in Prozent der Befragten; n = 198
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
„Wie bewerten Sie grundsätzlich die Datenqualität aus externen Open-Data-Angeboten von Behörden? Ich schätze die Daten als …….. hochwertig ein.“; in Prozent der Befragten; n = 197
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Dass Open Data in vielen Organisationen noch mit Vorsicht betrachtet wird, zeigt ein Blick auf die Einschätzung der Datenqualität externer Unternehmen und Behörden: Rund ein Drittel der Entscheiderinnen und Entscheider erlaubt sich hierzu kein oder nur ein fallabhängiges oder quellenabhängiges Urteil. Von einem Grundvertrauen in die Daten anderer Organisationen sind die Befragten damit noch weit entfernt.
Statt jedoch als Konsequenz auf die Datennutzung zu verzichten, sollten Organisationen Teil der Lösung werden. Das Investment zahlt sich mittelfristig aus: Daten aktiv zu prüfen und Erkenntnisse mit anderen zu teilen führt im Ergebnis zu „guten“ Daten, von denen alle profitieren. Daher sollten Unternehmen und Verwaltungen auf dem Gebiet Datenqualität stärker zusammenarbeiten und Standards entwickeln, die den Austausch innerhalb der gültigen Regeln erleichtern und Vertrauen schaffen.
Aus Sicht von etwa vier von zehn der Befragten hapert es an der Umsetzung von Open Data, weil niemand der Erste sein will. Das heißt, dass jede Organisation ihr eigenes Wissen schützt, aber vom Wissen anderer profitieren will. Zudem bremst auch hier die fehlende interne Offenheit. Daten werden schon innerhalb von Organisationen nur ungern geteilt.
Dazu kommt, dass Offenheit einen zusätzlichen Kommunikationsaufwand erzeugt. Wer Daten, Informationen oder Quellcode teilt, bekommt Feedback dafür. Während dieses Feedback in der IT erwünscht, nötig und etabliert ist, haben Fach-Teams deutlich mehr Hemmungen, Daten zu teilen und scheuen den Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern ihrer Daten. Darüber hinaus scheitert Open Data an der fehlenden Möglichkeit, Daten maschinell weiterzuverarbeiten. Viele Datensätze liegen in unstrukturierter Form vor, und es fehlen auch Handhabungen zur Standardisierung der Daten.
„Es hapert an der Umsetzung von Open Data, weil jede Organisation ihr eigenes Wissen schützt, aber vom Wissen anderer profitieren will. Niemand will der Erste sein.“¹
43%
¹ Zustimmungsquote; in Prozent der Befragten; n = 189
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Positiv stimmt, dass es den Befragten bei aller Zurückhaltung gegenüber Open Data nicht primär um ein Abschirmen nach außen geht: Nur wenige sehen in ihren Daten und ihrem Wissen fundamentale Ressourcen, die es um jeden Preis zu schützen gilt. Auslöser für die Scheu vor Datenaustausch sind eher in den beschriebenen Ängsten und Unsicherheiten zu suchen. Diese ergeben sich oft aus den regulatorischen, rechtlichen und IT-bedingten Hürden und den möglichen damit verbundenen Konsequenzen.
Statt in dieser passiven Position zu verharren, sollten Organisationen aktiv am Abbau dieser Hemmnisse arbeiten. Eine Datenstrategie schafft Leitplanken, die Mitarbeitende ermuntern, Daten in den gesetzten Grenzen offen zu teilen und davon zu profitieren.
„Unsere Daten und unser Wissen sind fundamentale Ressourcen. Darum müssen wir sie um jeden Preis schützen und können sie nicht mit externen Partnern teilen.“¹
16%
¹ Zustimmungsquote; in Prozent der Befragten; n = 189
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Fazit
Open Data ist zwar in aller Munde, aber für die Mehrheit der Entscheiderinnen und Entscheider in der Praxis keine Realität. Viele Organisationen sind nach wie vor mit ihrer digitalen Transformation beschäftigt. Daten werden häufig nicht strukturiert gespeichert und nur unsystematisch genutzt. Viele Datensätze erfüllen nicht einmal interne Qualitätskriterien und bieten sich daher kaum zum Teilen an. Hinzu kommen rechtliche und organisatorische Bedenken sowie die Angst vor einem Kontrollverlust und einem Missbrauch der Daten. Das Thema Offenheit steckt im Hinblick auf Open Data noch in den Kinderschuhen.
Vision einer Open Company
Die langfristige Idee von Open Company ist, dass sich Unternehmen und öffentliche Institutionen sowie einzelne Menschen und Gruppen immer wieder neu zusammenschließen, um übergreifende Probleme zu lösen, Antworten zu finden und Lösungen zu entwickeln. Eine wichtige Vision in diesem Zusammenhang ist das auf ein Werteversprechen zentrierte Unternehmen (französisch „l’entreprise promesse centrique“), das seinen Kundinnen und Kunden nicht mehr nur Produkteigenschaften garantiert, sondern auch Werte verspricht. Wie bei Open Source und Open Communities funktioniert die Zusammenarbeit über Schnittstellen, durch standardisierte Prozesse und maschinell verarbeitbare Daten. Ein zentraler Baustein ist zudem eine Kultur, die auf das Teilen ausgerichtet ist und die entsprechenden Tools nutzt.
Das richtige Mindset ist gefragt
„Welche der folgenden Maßnahmen ergreift oder plant Ihre Organisation, um eine offene Organisationskultur zu etablieren?“; in Prozent der Befragten; n = 192¹
¹ Darstellung ohne Antwortoptionen „weiß nicht/keine Angabe“ und „Sonstiges“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Um eine offene Organisationskultur zu schaffen, setzen Unternehmen und Behörden in Deutschland überwiegend auf klassische Arbeitsfaktoren: Das Mindset wird gefördert, intern Transparenz geschaffen und die Zusammenarbeit der Teams verbessert. Insbesondere die Finanzdienstleister haben sich überproportional häufig einem offenen Mindset verschrieben. Technologische Entwicklungen, veränderte Kundenanforderungen, verschärfte Regulatorik und aktuell die Zinswende erfordern Offenheit für und Anpassungsfähigkeit an externe Entwicklungen. Was Banken und Versicherer darüber hinaus stark verinnerlicht haben: Wer sich Innovationsökosystemen wie etwa Fintechs oder Insurtechs verschließt, bleibt mit seinen Herausforderungen allein.
Praktische Ansätze wie Data Sharing, Open Access und der gezielte Einsatz von Open Source oder digitaler Markplätze, um von externem Know-how oder Ressourcen zu profitieren, müssen sich flächendeckend noch durchsetzen. Das verarbeitende Gewerbe ist auf dem Gebiet am aktivsten — wenn es auch starke Unterschiede innerhalb der Branche gibt. Eine der primären Maßnahmen der Industrie in puncto offene Organisationskultur ist die intensivere Zusammenarbeit mit Externen. Das passt zu den gemeinsamen Anstrengungen von deutschen Automobilherstellern etwa im Bereich autonomes Fahren. Damit bewegen sie sich am Puls der Zeit, denn eine individuelle Entwicklung ist deutlich kostenintensiver — ohne zwangsläufig zu besseren Ergebnissen zu führen. Zudem etablieren sich Marktstandards eher im Verbund.
Für Verwaltungen spielt das Kultivieren einer offenen Mentalität aktuell nur eine untergeordnete Rolle. Behörden sind stark damit beschäftigt, interne Synergien zu erzielen und die Beteiligungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden zu erweitern. Es gilt also erstmal, einen (kulturellen) Rahmen zu schaffen, in dem sich mehr Menschen produktiv in den Innovationsprozess einbringen können.
Engagement in Communities fördern
Ein offenes Zusammenwirken geht über Organisationsgrenzen hinaus: Initiativen haben Mitglieder oder Sponsoren aus allen Teilen der Gesellschaft, und die Akteure teilen ihr Wissen und ihre Kompetenzen auf Plattformen. Unternehmen und Verwaltungen profitieren, indem sie Lösungen für ihre Herausforderungen oder weiterführende Impulse finden. Das Prinzip offener Communities funktioniert auf Dauer allerdings nur, wenn sich alle auch engagieren.
Das Engagement ist im Durchschnitt verhalten: Die Hälfte der befragten Organisationen nimmt vor allem an Workshops und Konferenzen teil. Die Industrie ist aktiver als andere Branchen. Jedes dritte Industrieunternehmen stellt Mitarbeitende frei, damit sie sich in Communities einbringen oder die Mitglieder der Communities durch Coaching/Mentoring unterstützen. Einige Betriebe fördern Co-Creator-Initiativen zudem monetär.
Erneut zeigt sich, wie wichtig Forschungskooperationen für die Industrie sind. Durch den Fachkräftemangel wissen die Unternehmen, dass sie sich nachhaltig öffnen müssen. Keiner kann es sich leisten, dass das Engagement der Open Communities plötzlich endet und dieser zunehmend wichtigere Innnovationsmotor ins Stocken gerät.
„Welche Möglichkeiten nutzt Ihr Unternehmen bzw. Ihre Verwaltung, um Open Communities zu unterstützen oder dies zukünftig zu tun?“; in Prozent der Befragten; n = 191¹
¹ Darstellung ohne Antwortoption „weiß nicht/keine Angabe“
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Vernetzt durch Technik
Eine starke interne und externe Vernetzung ist Teil des Erfolgsrezepts von Open Company. Moderne Technologien spielen dabei eine zentrale Rolle: Open Source, Open Data, Open Business und Open Government wären ohne sie nicht denkbar. Künstliche Intelligenz (KI) bietet Organisationen große Potenziale, wenn sie die Technik strategisch sinnvoll in ihre Prozesse integrieren.
In diesem Zusammenhang bejahen drei von zehn Befragten, dass KI in Zukunft kein Werkzeug, sondern ein Partner sein wird. Die Fortschritte bei der generativen KI ebnen den Weg dahingehend. Trotz dieser Ansicht der Befragten hinsichtlich einer Co-Creation mit KI vertritt nur eine Minderheit die Auffassung, dass Organisationen mehr Daten zur Entwicklung von KI besteuern sollten. Es gilt die Devise: „Smart Follower“ ist besser als „First Mover“. Unternehmen und Verwaltungen unterschätzen hier ihre Verantwortung und die Chance, sich mittels neuer Technologie noch stärker zu vernetzen und offene System als Problemlöser einzusetzen.
„Künstliche Intelligenz wird in Zukunft kein Werkzeug, sondern ein Partner sein.“¹
30%
¹ Zustimmungsquote; in Prozent der Befragten; n = 189
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
„Organisationen müssen mehr Daten zur Verfügung stellen, damit KI schneller entwickelt werden kann.“¹
28%
¹ Zustimmungsquote; in Prozent der Befragten; n = 189
Quellen: F.A.Z.-Institut, Sopra Steria
Fazit
Eine offene Kultur zeigt sich darin, dass Know-how und Informationen mit Hilfe intelligenter Technologie zusammengeführt und Organisationsgrenzen überwunden werden. Statt wirkliche Open Companies zu sein, sind Wirtschaft und öffentliche Verwaltung in Deutschland derzeit kulturell eher verschlossen. Hierzulande herrscht beispielsweise in der Fläche eine andere Innovationskultur als in anderen europäischen Ländern. Dennoch tut sich etwas, dafür sorgen etwa die großen Transformationsthemen: Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit sind die drei wichtigsten Gebiete, auf denen Unternehmen die Zusammenarbeit suchen. Im Public Sector findet zudem gerade eine signifikante Öffnung in Richtung Zusammenarbeit mit Start-ups statt. Das zeigt, dass der kulturelle Wandel begonnen hat. Nun sollte er noch an Fahrt gewinnen.
Kontakt
Sopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen — und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes.
Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2022 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.
Ansprechpartner:
Sopra Steria SE
Nils Ritter
Pressesprecher
E-Mail:
presse.de@soprasteria.com
Tel.: +49 151 40625911
Webseite: soprasteria.de