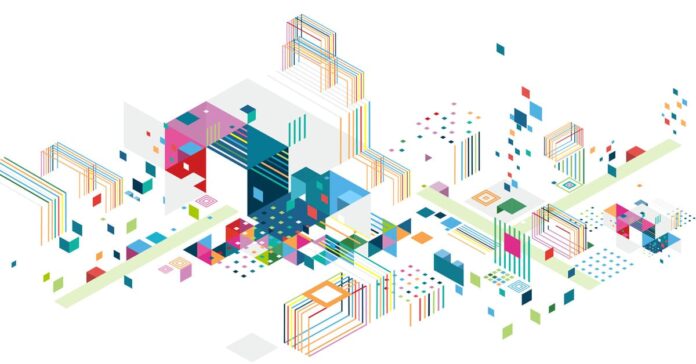Sie haben für die Studie Smart City Matters einige Interviews geführt und unterschiedliche Projekte kennengelernt. Was waren für Sie die Highlights?
Es ist schwierig, Highlights zu nennen, da ich viele Projekte sehr beeindruckend finde – sowohl in Deutschland als auch international. Für mich ist es spannend zu sehen, welche Smart-City-Anwendungen die Städte umgesetzt haben und wie praktikabel diese sind. Bei Heidelberg hat mich besonders die Herangehensweise überzeugt, denn die Stadt setzt auf Bottom-up-Strategien, um Projekte und ihre Finanzierungen selbst auf die Beine zu stellen – ohne auf eine Finanzierung „von oben“ zu warten. Bei Ahaus hat ihre herausragende Digitalstrategie herausgestochen. Ein spannendes Konstrukt war für mich auch die Smart City Mannheim, die einen starken Fokus auf Dekarbonisierung hat.
Zu einer Smart City führen also viele Wege?
Eine Smart City lebt von der Vielfalt ihrer thematischen Felder. Damit eine smarte Stadt gelingen kann, ist es nötig, Silos in der Verwaltung aufzubrechen und auch die Zusammenarbeit mit Industrie und Forschung voranzutreiben. Best Practices und Benchmarks müssen gesammelt werden, um jeweils passende Anwendungen für die Städte zu finden. Und will man langfristig erfolgreich Projekte umsetzen, ist es unabdingbar, über den politischen Rahmen, wie einen Wahlzyklus, hinauszudenken.

©privat
Gibt es derzeit thematische Schwerpunkte oder Trends bei Smart-City-Projekten?
In Deutschland spielt die Verwaltung eine große Rolle. Für Stadtverwaltungen kann ein Bewertungsmodell sehr hilfreich und zielführend sein. So kann man priorisieren, welches Thema am meisten drängt, und sich dann Gedanken um die Finanzierung machen. Im Rahmen von Bottom-up-Initiativen, Living Labs oder Reallaboren kann sehr viel getestet und umgesetzt werden. Bei der Realisierung von Projekten kommt es aber auch auf die Gegebenheiten der jeweiligen Stadt an. Dafür ein kurzer Blick ins Ausland: Tallinn ist als Stadt kompakt und übersichtlich. Das kann ein Vorteil sein, um Digitalisierungsprojekte vergleichsweise schnell umzusetzen.
Was waren für Sie vielversprechende Lösungsansätze in der Zusammenarbeit zwischen Städten und Kommunen?
Mit dem Leitgedanken „Wie verbessere ich die Lebensqualität der Stadtbewohner?“ kann viel erreicht werden. Außerdem werden gute Lösungen gefunden, wenn Bürger beteiligt werden. Denn mit einem „Sense of Ownership“ identifizieren sich die Menschen stärker mit ihrer Stadt. In Hannover beispielsweise spielt dieser Identifikationsgedanke in Smart-City-Projekten eine große Rolle. Über ein Zusammengehörigkeitsgefühl wird wiederum auch die Partizipation der Bürger gestärkt. Die Stadt Ahaus ist in diesem Bereich mit ihrer eigenen digitalen Plattform und einer City-App sehr aktiv, die sie zusammen mit dem Softwareunternehmen Tobit entwickelt hat. Ein weiteres gutes Beispiel ist KelsterVoice, eine Plattform der Stadt Kelsterbach, die Bürgerbeteiligung im 3D-Stadtmodell ermöglicht.
Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass eine Kooperation zwischen Städten und Unternehmen und/oder Forschungseinrichtungen erfolgreich ist?
In der Zusammenarbeit zwischen einer Stadt und einer Forschungseinrichtung oder einem Unternehmen braucht es Persönlichkeiten als Treiber, die Fragestellungen voranbringen und zukunftsorientiert denken. Es ist sinnvoll, mit Unternehmen vor Ort zusammenzuarbeiten. Die Leitfragen für Projekte sollten sein: Wo bekommen wir die besten Ideen? Und: Wie können wir das mit unseren Ressourcen umsetzen?
Die Innovationsgemeinschaft EIT Urban Mobility finde ich beeindruckend: Sie fördert Start-ups und Veranstaltungen für nachhaltige Projekte im Themenbereich städtische Mobilität. Ein weiteres gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von Städten und Forschungseinrichtungen ist das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), das Städte bei der klimaneutralen Transformation unterstützt. Aber auch die Zusammenarbeit zwischen Kommunen ist wichtig, um bereits bestehende und gut funktionierende Smart-City-Lösungen voneinander übernehmen zu können.
Wenn wir in die Zukunft blicken, welche langfristigen Perspektiven sehen Sie für Smart-City-Projekte in Deutschland?
In Deutschland sehe ich einen Trend in den Bereichen Mobilität und Energie. Es gibt hierzulande eine sehr starke Automobilbranche und diese Stärken muss man nutzen. Die Zuwanderung von Fachkräften sehe ich ebenfalls als großes Potenzial. Deutschland hat einen guten Geist, um zukünftig effektive Lösungen zu entwickeln.
Erwarten Sie international die gleichen Trends?
International gesehen, ist es vorteilhaft, Projekte zu übernehmen, die bereits andernorts implementiert sind und gezeigt haben, dass sie funktionieren. Man muss nicht bei jedem Projekt das Rad neu erfinden. Wir sollten unsere Resilienz stärken, um mit Unwägbarkeiten und Rückschlägen umzugehen. Bei der Zusammenarbeit über Grenzen hinweg zählt es, flexibel und zuversichtlich zu bleiben. Und natürlich sollte man zukünftig darauf achten, nicht zu sehr in Verwaltungsprozessen festzustecken – das gilt für Deutschland, aber auch für andere Länder.
Gibt es für Sie Vorbilder im Bereich Smart City?
Das ist schwierig zu bewerten, da eine Smart City aus vielen Komponenten bestehen kann. Für mich ist eine smarte Stadt vor allem eines: lebenswert. Die Menschen müssen sich wohlfühlen – das bedeutet, alle Gesellschaftsteile einzubeziehen. Beim Thema Inklusivität fallen mir die Städte Bottrop und Gelsenkirchen ein, dort wird das gut gelebt. Eine herausragende Stadt ist auch Cascais in Portugal. Dort habe ich Cascais Ambiente kennengelernt, ein städtisches Unternehmen, das sich um den bewohnergerechten und nachhaltigen Umbau der Stadt kümmert. Die Philosophie von João Dinis, Climate Action Director von Cascais, hat mich sehr beeindruckt. Sein oberstes Ziel ist es, Cascais lebbar für die Bürger zu machen und die Stadt so zu gestalten, dass auch seine Urenkel noch dort wohnen möchten. Mir wurde durch dieses Beispiel erneut bewusst: Um eine Smart City zu gestalten, hängt viel von Einzelpersonen ab, die sich für ihre Stadt einsetzen.